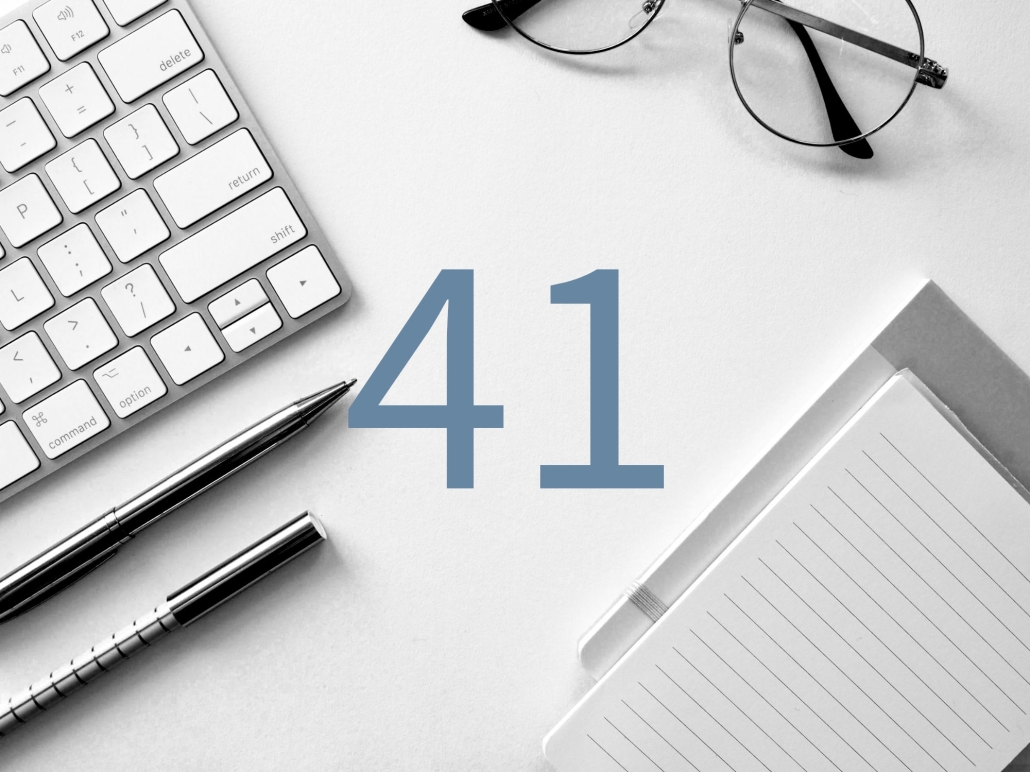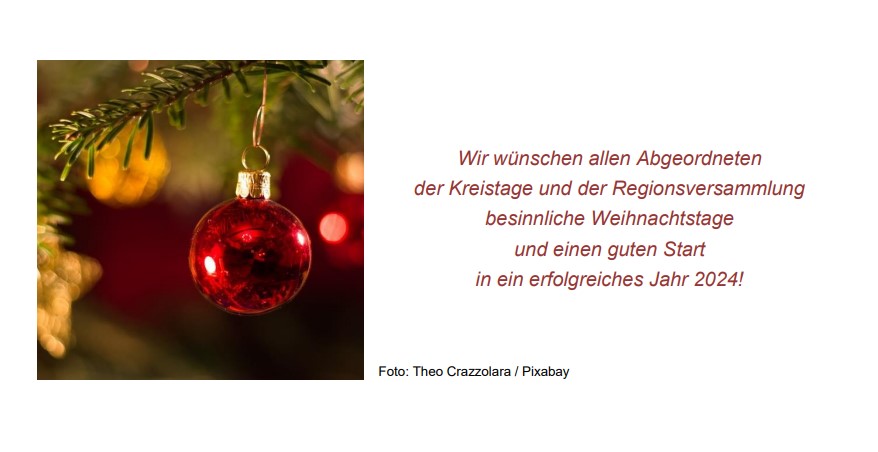Gesetz zur Verbesserung des Klimaschutzes beschlossen
Am 11. Dezember 2023 hat der Landtag ein Artikelgesetz zur Verbesserung des Klimaschutzes entsprechend der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses beschlossen (LT-Drs. 19/3056). Den Schwerpunkt der Novelle stellen die Änderungen desNiedersächsischen Klimagesetzes (NKlimaG) dar. Die niedersächsischen Klimaziele werden mit der Novelle angehoben und der Minderungspfad verkürzt. Bis 2030 sollen dieTreibhausgasemissionen des Landes um 75 Prozent verringert werden, bis 2035 um90 Prozent und im Jahr 2040 Treibhausgasneutralität soll erreicht werden. Zudem ist derBereich der Klimafolgenanpassung als Zielsetzung aufgenommen worden.
Ein eigenständiges Ziel für den Ausbau der Windenergie (neben dem NiedersächsischenWindgesetz) konnte mit großem Aufwand der Geschäftsstelle des NiedersächsischenLandkreistages (NLT) verhindert werden. Vorgesehen ist nunmehr eine rechtsfolgenloseHinwirkungspflicht. Vorhaben zur Erreichung der niedersächsischen Klimaziele liegen nunmehr im überragenden öffentlichen Interesse. Dadurch soll der Klimaschutz in Zulassungs- oder Genehmigungsverfahren nach Landesrecht ein besonderes Gewicht erhalten(„Klimavorrang“).
Die Planung von Freiflächenanlagen für Photovoltaik ist nunmehr als Grundsatz derRaumordnung ausgestaltet. Geregelt sind dort sowohl Gunst- (z.B. wiedervernässbareFlächen, altlastenverdächtige Flächen) als auch Ausschlussflächen (z.B. Böden mit einerGrünland- und Ackerzahl von 50 oder mehr). Künftig ist ein sogenannter Klimarat vorgesehen. Dieser soll die Landesregierung in Bezug auf die Weiterentwicklung der Klimaschutzpolitik beraten. Vor dem Erlass von Gesetzen und Verordnungen sowie bei Maßnahmenvon finanzieller Bedeutung sind die Auswirkungen auf die Klimaziele zukünftig zu prüfen(„Klimacheck“).
Die Einführung eines kommunalen Klimaschutzmanagements zur Umsetzung der Klimaschutzkonzepte ist ab dem 1. Januar 2026 vorgesehen. Das Gesetz sieht für diese neueAufgabe zusätzliche Zuweisungen des Landes für eine halbe Vollzeitpersonalstelle derEntgeltgruppe 12 ebenfalls ab dem 1. Januar 2026 vor. Im Bereich der kommunalen Wärmeplanung ist derzeit allein die Rechtsgrundlage für die Datenerhebung und damit ein etwas erleichterter und kostenfreier Zugang der Kommunen zu den Daten der örtlichenEnergieversorger für eine fachgerechte Planung der Wärmenetze angepasst worden.Sämtliche weiteren Regelungen zur Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung, insbesondere zu der anstehenden verpflichtenden Umsetzung des Wärmeplanungsgesetzesdes Bundes, waren ausdrücklich nicht Gegenstand der Gesetzesnovelle.
Weitere Änderungen betreffen Einzelheiten des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes, der Niedersächsischen Bauordnung, des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes,der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung und des Niedersächsischen Wassergesetzes.
Finanzierung der Flüchtlingskosten 2023/des Katastrophenschutzgesetzes
Der Niedersächsische Landtag hat am 14. Dezember 2023 das Gesetz zur Änderung desNiedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich des Aufnahmegesetzes sowie zurÄnderung des Niedersächsischen Katastrophenschutzgesetzes ohne Änderungen mit denStimmen von SPD, Grünen und CDU beschlossen (Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Sport – LT-Drs. 19/3059).
Die in dem Gesetz vorgesehenen zusätzlichen Flüchtlingsmittel (Art. 2) in Höhe von95 Millionen Euro für 2023 werden somit – auch entsprechend des Votums des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes (NSGB) und des Niedersächsischen Landkreistages (NLT) – komplett nach den Regelungen des § 4b des Aufnahmegesetzes aufdie kommunalen Aufgabenträger verteilt. Dem Vernehmen nach soll der Betrag noch dieses Jahr ausgezahlt werden.
Auch die vorgesehene Regelung zur Änderung des Niedersächsischen Katastrophenschutzgesetzes mit einer Regelung der Zuständigkeit der zivilen Alarmplanung und einerEinmalzahlung an die Kommunen wurde beschlossen. Das Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.
Rettungsdienst: Übergangsfrist verlängert
Der Niedersächsische Landtag hat am 11. Dezember 2023 einstimmig beschlossen, dieÜbergangsfrist für die Besetzung des Rettungswagens (RTW) mit Rettungsassistentinnenund Rettungsassistenten bis Ende 2026, also um weitere drei Jahre, zu verlängern. Ursprünglich wäre diese Übergangsfrist am 31. Dezember 2023 ausgelaufen. Der nun beschlossene Änderungsantrag in der Fassung der Beschlussempfehlung des Innenausschusses sieht eine Verlängerung bis 31. Dezember 2026 vor (LT-Drs. 19/2960). In derschriftlichen Stellungnahme hatte der Niedersächsische Landkreistag (NLT) eine Verlängerung um maximal zwei Jahre empfohlen, der Niedersächsische Städtetag (NST) hattesich für drei Jahre ausgesprochen. Der Umstand, dass es nun zu einer Verlängerung umdrei Jahre gekommen ist, hat auch verfahrensmäßige Gründe. So hat ausweislich desSchriftlichen Berichts (LT-Drs. 19/2995) die CDU-Fraktion damit gedroht, ihren Gesetzentwurf, der eine unbefristete Ausnahmeregelung vorgesehen hatte, zum Plenum zurückzuziehen, wenn man nicht der Forderung nach einer dreijährigen Verlängerung zustimme. ImSchriftlichen Bericht ist zudem angekündigt, dass dies „aus Gründen der Qualitätssicherung“ die letzte Fristverlängerung bleiben müsse.
Gesetz zur Einführung einer pauschalen Beihilfe
Der Niedersächsische Landtag hat am 11. Dezember 2023 mit den Stimmen der Regierungsfraktionen gegen das Votum der Opposition den Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer pauschalen Beihilfe in Niedersachsen in der Fassung der Beschlussempfehlungdes Ausschuss Haushalt und Finanzen beschlossen (LT-Drs. 19/3057).
Kern des Gesetzes ist die Einfügung eines neuen § 80 a in das Niedersächsische Beamtengesetz, das künftig die pauschale Beihilfe regelt. Danach kann anstelle einer Beihilfenach § 80 künftig eine monatliche pauschale Beihilfe zu einer freiwilligen gesetzlichenoder einer privaten Krankheitskostenvollversicherung nach Maßgabe der Bestimmungendes § 80 a gewährt werden (sogenanntes Hamburger Modell). Die Gewährung der pauschalen Beihilfe, die faktisch den Verbleib in der gesetzlichen Krankenversicherung ermöglicht, erfolgt nur auf Antrag und unter Verzicht auf die Einzelbeihilfen nach § 80. Dieweiteren Regelungen des Gesetzentwurfs sind im Wesentlichen unverändert geblieben:So ist der Antrag für Bestandsbeamte innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr zustellen, die Frist beginnt am 1. Februar 2024. Neu aufgenommen wurde auf unsere Anregung ein neuer Abs. 13, der in besonderen Härtefällen für einzelne Leistungen eine Beihilfe nach § 80 ermöglicht.
Das Modell der pauschalen Beihilfe könnte insbesondere auch im Bereich der Neueinstellung von Fach- und Führungskräften und/oder bei kommunalen Wahlbeamtinnen undWahlbeamten besonders für lebensältere Bewerberinnen und Bewerber relevant sein, diebisher ausschließlich gesetzlich krankenversichert gewesen sind.
Landeshaushalt 2024 und Haushaltsbegleitgesetz 2024
Der Niedersächsische Landtag hat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2023 das Haushaltsgesetz 2024 und das Haushaltsbegleitgesetz 2024 verabschiedet. Das Haushaltsgesetz 2024 wurde entsprechend der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Haushaltund Finanzen (LT-Drs. 19/3000) in der Fassung der zweiten Beratung (LT-Drs. 19/3100)beschlossen. Vorgesehen sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 42,4 MilliardenEuro. Nettokreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. Es sollen 118,3 Millionen Euro getilgtwerden. Gleichzeitig ist eine Rücklagenentnahme von 408,6 Millionen Euro vorgesehen.Der Finanzierungssaldo des Landes beträgt nach der Planung im Jahr 2024-290,1 Millionen Euro. Aus kommunaler Sicht ist an folgende Änderungen gegenüber demEntwurf zu erinnern:
– die Etatisierung der Breitbandförderung für das nächste Haushaltsjahr (für die Folgejahre muss noch eine weitere Weiterfinanzierung erreicht werden);
– die Anpassung der Höhe der Mittel für den kommunalen Straßenbau auf die im bestehenden NGVFG vorgesehene Höhe von 75 Millionen Euro;
– die Etatisierung zusätzlicher Mittel für Fluchtgeschehen in Höhe von 115 Millionen Eurofür die Kommunen in 2024 – über die Verteilung wird im Folgejahr noch eine Verständigung herbeigeführt werden müssen.
Gleichzeitig hat der Niedersächsische Landtag das Haushaltsbegleitgesetz 2024 in derFassung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen beschlossen (LT-Drs. 19/3020). Einzelheiten können dem ergänzenden Schriftlichen Berichtentnommen werden (LT-Drs. 19/3064). Auf folgende Punkte wird hingewiesen:
– Art. 2 (Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz): Hier werden die Beträge für dieZuweisungen des übertragenen Wirkungskreises festgelegt.
– Art. 5/1 (Gesetz über Verordnung und Zuständigkeiten): § 11 des Gesetzes wurde gestrichen. Hiermit entfällt die Rückübertragungspflicht für im Zuge der Verwaltungs- undGebietsreform auf die Kommunen übergegangene Grundstücke von Gesundheits- undVeterinärämtern.
– Art. 8 (Sondervermögen zur Förderung von Krankenhausinvestitionen): Es werden Regelungen geschaffen, um als einen Teil zur Erhöhung der Krankenhausinvestitionen dem Sondervermögen jährlich 75 Millionen Euro (davon 40 Prozent kommunal finanziert) zuzuführen.
– Art. 9 (Niedersächsisches Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege):Hier wird die Finanzhilfe für Kinderkrippen grundsätzlich von 56 auf 59 vom Hundertangehoben. Hintergrund ist eine vereinbarte Anpassung zur Revision bei gestiegenenBetreuungsquoten. Darüber hinaus wird die Regelung über besondere Finanzhilfe fürKräfte in Ausbildung (§ 30) neu gefasst
Niedersächsisches Hinweisgebermeldestellengesetz beschlossen
Der Niedersächsische Landtag hat das Niedersächsische Hinweisgebermeldestellengesetz in der Fassung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Sport beschlossen (LT-Drs. 19/3058). Die Zustimmung erfolgte mit den Stimmen der Regierungsfraktionen bei Enthaltung der Oppositionsfraktionen am 14. Dezember 2023. Ausweislichder Beschlussempfehlung sind am Gesetzestext nur redaktionelle Änderungen erfolgt.
Dementsprechend beschreibt das Gesetz in § 1 die grundsätzliche Verpflichtung jederKommune zum Betrieb mindestens einer internen Meldestelle gemäß § 12 des Hinweisgeberschutzgesetzes des Bundes. § 1 Abs. 2 erstreckt diese Verpflichtung auch auf kommunale Anstalten, Zweckverbände und alle sonstigen Beschäftigungsgeber, die im Eigentumoder unter der Kontrolle von Kommunen stehen. Die vorgesehenen Ausnahmen in § 2 fürKommunen mit weniger als 10.000 Einwohnern oder Kommunen und Beschäftigungsgeber mit weniger als 50 Beschäftigten sind erhalten geblieben. Die Möglichkeit der Zusammenarbeit von Kommunen zum Betrieb einer gemeinsamen Stelle ist noch etwas stärkerherausgearbeitet und die Möglichkeit, eine vom Innenministerium benannte staatlicheStelle einzuschalten, redaktionell etwas anders formuliert worden.
Das Innenministerium hat auf Nachfrage mitgeteilt, dass es derzeit einen Leitfaden zurUmsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes für den kommunalen Bereich erarbeite. Unsere auch in der Anhörung erhobene Forderung, zentral Schulungen anzubieten, möchtedas Innenministerium nicht aufgreifen, plant aber einen Erfahrungsaustausch für die Kommunalverwaltungen zum Umsetzung des Gesetzes in ca. sechs Monaten.
IMAK zur Vereinfachung Niedersächsischer Förderprogramme
Im Oktober 2023 hat die Landesregierung die Einrichtung eines Interministeriellen Arbeitskreises (IMAK) unter Beteiligung aller Ressorts einschließlich der Niedersächsischen Staatskanzlei beschlossen mit dem Ziel, die Kommunen, Verbände und Vereine durch dieVereinfachung der Verfahren bei Förderprogrammen auch mit Hilfe der digitalen Möglichkeiten zu entlasten (IMAK Vereinfachung Förderprogramme). Federführend ist das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport (MI), bei dem eine Geschäftsstelle eingerichtet wurde. Die Landesregierung hat den IMAK beauftragt, zunächst
– sich einen Überblick über die Förderprogramme des Landes zu verschaffen, mit denenKommunen gefördert werden;
– rechtliche und organisatorische Grundlagen für die Vereinfachung und Vereinheitlichung dieser Förderprogramme, insbesondere der Antrags- und Genehmigungsverfahren, unter Ausschöpfung der digitalen Möglichkeiten herauszuarbeiten;
– diejenigen Förderprogramme zu identifizieren, bei denen eine pauschale Zahlung anKommunen möglich wäre;
– ihr binnen eines Jahres nach Einsetzung des IMAK konkrete Handlungsempfehlungenfür eine Vereinfachung von Verfahren und für pauschale Zahlungen an Kommunen vorzulegen.
Die Landesregierung hat den IMAK ferner beauftragt, im Anschluss auch die Förderprogramme für Vereine, Verbände und Wirtschaftsunternehmen zu untersuchen und Vorschläge für eine Vereinfachung von Verfahren und für pauschale Zahlungen vorzulegen.
An der konstituierenden Sitzung des IMAK Vereinfachung Niedersächsischer Förderprogramme am 4. Dezember 2023 unter Vorsitz von Staatsekretär Stephan Manke (MI) haben die Ressorts der Landesregierung auf Staatssekretärsebene, der Vorstandsvorsitzende der NBank sowie die Hauptgeschäftsführer/Präsidenten der drei kommunalen Spitzenverbände teilgenommen. Es wurde eine Meilensteinplanung bezüglich des Arbeitsauftrages des IMAK zustimmend zur Kenntnis genommen. In einem ersten Arbeitsschritt sinddie Fachressorts der Landesregierung aufgefordert, bis zum 20. Dezember 2023 sämtlicheFörderprogramme mit kommunalen Empfängern der Geschäftsstelle des MI zu melden.
Krankenhausreform und Krankenhaustransparenzgesetz
Bekanntlich hat der Bundesrat am 24. November 2023 das vom Deutschen Bundestag beschlossene Gesetz zur Einführung eines Transparenzverzeichnisses für Klinikleistungen(Krankenhaustransparenzgesetz) in den Vermittlungsausschuss überwiesen. Da in diesemGesetz auch Maßnahmen zur Liquiditätsverbesserung, wenn auch unzureichend, enthalten waren, wäre eine schnelle Durchführung des Vermittlungsverfahrens sinnvoll gewesen. In den Vorgesprächen konnten sich Bund und Länder jedoch nicht auf eine Kompromisslinie verständigen. In diesem Jahr wird der Vermittlungsausschuss nicht mehr tagen.
Wahrscheinlich in Folge der Schwierigkeiten beim Krankenhaustransparenzgesetz liegtauch der vom Bundesgesundheitsminister angekündigte Arbeitsentwurf zur Krankenhausreform, der bis zum 1. Dezember 2023 vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) vorgelegt werden sollte, bislang nicht vor. Wann das BMG diesen Arbeitsentwurf versendenwill, ist derzeit offen.
„Funktionsgerechte Krankenhausfinanzierung und Krankenhausreform“
Ein Gutachten zur Krankenhausfinanzierung haben der Bundesverband Deutscher Privatkliniken, der Deutsche Evangelische Krankenhausverband, das Deutsche Rote Kreuz undder Katholische Krankenhausverband Deutschlands bei Professorin Dr. Frauke BrosiusGersdorf (Universität Potsdam) in Auftrag gegeben. Das Gutachten kommt unter anderemzu dem Ergebnis, dass der selektive Defizitausgleich eines Landes nur für staatliche Krankenhäuser gegen das gesetzliche und verfassungsrechtliche Gebot der Gleichbehandlungder Plankrankenhäuser verstoße. Gleiches gelte für einen selektiven Defizitausgleich vonKommunen nur für eigene Krankenhäuser. Zudem seien auf eigene Krankenhäuser beschränkte Ausgleichsleistungen von Kommunen oder Ländern eine unzulässige Beihilfe imSinne des Art. 107 Abs. 1 AEUV.
Aus Sicht der Hauptgeschäftsstelle des Deutschen Landkreistages (DLT) bewertet die Autorin u.a. den Nutzen, den gerade private Krankenhäuser und deren Träger aus Gewinnenin der Vergangenheit ziehen, die vorrangiges Ziel der zumeist in Form einer Aktengesellschaft organisierten privaten Träger sind, in nicht ausreichender Weise.
Niedersächsische Krankenhausverordnung veröffentlicht
Am 24. November 2023 ist die Niedersächsische Krankenhausverordnung (NKHVO) imGesetz- und Verordnungsblatt (S. 281) veröffentlicht worden und am Tag darauf in Kraftgetreten. Die NKHVO beschränkt sich derzeit im Wesentlichen auf die Zuordnung derLandkreise und kreisfreien Städte zu den nunmehr acht Versorgungsregionen und regeltEinzelheiten zu den Regionalen Gesundheitszentren. Sobald Klarheit hinsichtlich derhöchst streitig diskutierten Krankenhausreform auf der Bundesebene erreicht ist, wird esAnpassungsnotwendigkeiten des Niedersächsischen Krankenhausgesetzes und derNKHVO geben.
Drei neue Projektförderungen für Gesundheitsregionen
2024 erhalten drei niedersächsische Gesundheitsregionen eine Projektförderung, wie dasNiedersächsische Gesundheitsministerium am 15. Dezember 2023 mitteilte. Die Projektewerden von den Kooperationspartnern der Gesundheitsregionen, der AOK Niedersachsen,vdek – Verband der Ersatzkassen, BKK Landesverband Mitte, IKK classic, der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen und der Ärztekammer finanziell unterstützt. Gesundheitsminister Dr. Andreas Philippi betonte den hohen Stellenwert der Gesundheitsregionen und erklärte in einer Pressemitteilung, er freue sich, dass in diesem Jahr hochkarätige Bewerbungen zur Stärkung der wichtigen Bereiche Kinderversorgung und Notfallrettung ausgewählt werden konnten. Ausgewählt wurden:
– Kinder psychisch kranker Eltern – Früher Kontakt, Diagnostik, Hilfe (GesundheitsregionDelmenhorst)
– KIDZ-GENIAL – Kinder zusammen Stärken (Gesundheitsregion Gifhorn)
– Erleben – Erhöhung der Überlebensrate nach Herzstillstand durch Laien-Ersthilfe (Gesundheitsregion Vechta)
Der Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Landkreistages (NLT), Prof. Dr. HubertMeyer, begrüßte die Projektförderung durch die Kooperationspartner. Gleichzeitig betonteer in der Pressemitteilung, die von den Landkreisen und kreisfreien Städten getragenenGesundheitsregionen hätten sich, unabhängig von Einzelprojekten, zu einem unentbehrlichen Partner zur Vernetzung der Akteure im Gesundheits- und Pflegewesen entwickelt.Die kommunale Verankerung erlaube es, den Verhältnissen vor Ort gerecht zu werdenund zielgenau Schwerpunkte zu setzen. Der NLT werde 2024 mit dem Land Niedersachsen über eine Aufstockung der bisherigen Strukturförderung sprechen, die der tatsächlichen Bedeutung der Gesundheitsregionen gerecht werde.
13. Niedersächsischer Gesundheitspreis
Am 4. Dezember 2022 wurde der 13. Niedersächsische Gesundheitspreis durch MinisterDr. Andreas Philippi verliehen. Der Preis wird gemeinsam vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung (MS), vom Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Bauen, Verkehr und Digitalisierung (MW), von der AOK Niedersachsen, der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) und der Apothekerkammer Niedersachsen gemeinsam ausgelobt und ist mit insgesamt 15.000 Euro dotiert. Minister Philippi (MS) ist der Schirmherr des Wettbewerbs.
Die mit jeweils 5.000 Euro dotierten Auszeichnungen gingen an folgende Preisträgerinnenund Preisträger:
– Kategorie Chronisch krank und gut versorgt: Jobcenter Region Hannover, Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie der Medizinischen Hochschule Hannover,Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft;
– Kategorie Gesundheitsförderung und -versorgung mit und für Menschen mit Behinderung: Lebenshilfe Hannover;
– Kategorie eHealth – Neue Chancen im Gesundheitswesen: Medizinische HochschuleHannover – Institut für Humangenetik und Projektpartnerinnen und -partner.
Weitere Informationen zum Niedersächsischen Gesundheitspreis stehen auf der Homepage zur Verfügung: www.gesundheitspreis-niedersachsen.de.
Gleichstellungsbeauftragte: Gesetzentwurf der AfD-Fraktion
Die AfD-Fraktion hat einen Gesetzentwurf zur Änderung des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes und des Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes in denLandtag eingebracht. Nach Beratung im Verfassungs- und Europaausschuss des Niedersächsischen Landkreistages (NLT) sowie Abstimmung innerhalb der Arbeitsgemeinschaftder kommunalen Spitzenverbände hat der NLT dem Niedersächsischen Landtag gegenüber mitgeteilt, dass verfassungsrechtliche Bedenken im Hinblick auf die Verpflichtung von§ 8 NKomVG, nur Frauen zu Gleichstellungsbeauftragten zu ernennen, angesichts der immer noch festzustellenden faktischen Ungleichheit nicht zu erkennen sind. Auch hinsichtlich der Veränderung der Einwohnergrenze, ab der hauptberufliche Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen sind, hat der NLT keinen aktuellen Veränderungsbedarf signalisiert.
Änderungsanträge zum Bundeshaushalt
Zum Haushaltsfinanzierungsgesetz liegen im Deutschen Bundestag drei Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen vor. Mit dem ersten soll mit Blick auf das Haushaltsjahr 2023dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November 2023 Rechnung getragenwerden. Der zweite Änderungsantrag betrifft insbesondere die angewendete Zuständigkeitsverlagerung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten unter 25 Jahren (U25) vomJobcenter in die Agenturen für Arbeit, die durch eine Verlagerung der Rehabilitation sowieder Förderung der beruflichen Weiterbildung für SGB II-Empfänger in das SGB III ersetztwerden soll. Mit einem weiteren Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen zum Haushaltsfinanzierungsgesetz soll durch eine Änderung der Bundeshaushaltsordnung erreicht werden, dass Zuwendungen an Kommunen (Gemeinden und Landkreise) bis zur Höhe vonsechs Millionen Euro grundsätzlich als Festbetragsförderung gewährt werden und der Verwendungsnachweis grundsätzlich im vereinfachten Verfahren erfolgt. Das Nähere soll eineRechtsverordnung regeln, die der Zustimmung des Haushaltsausschusses des DeutschenBundestages bedarf.
Breitbandausbau: Entwurf Richtlinienänderung RL Graue Flecken NI
Das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung(MW) hat den Entwurf der Richtlinienänderung über die Kofinanzierung des Bundesförderprogrammes „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland – Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 (Gigabit-RL2.0)“ aus Mitteln des Sondervermögens für den Ausbau von hochleistungsfähigen Datenübertragungsnetzen und für Digitalisierungsmaßnahmen (RL Graue Flecken NI) mit derGelegenheit zur Stellungnahme übersandt.
Der Bund setzt zum 1. April 2024 den Wegfall der sogenannten Aufgreifschwelle um undfördert auch Adressen, die einen Internetanschluss von über 100 Mbit/s haben. Um dieFörderverfahren des Landes und des Bundes weiterhin weitestgehend zu synchronisierenund den bei den kommunalen Antragsstellenden entstehenden Verwaltungsaufwand zuminimieren wird vorgeschlagen, die laufende Richtlinie des Landes dahingehend zu erweitern, dass sie auch die neue Richtlinie des Bundes abbildet. An den Förderkonditionen derKofinanzierung ändert sich nichts.
Breitbandausbau im ländlichen Raum: Sitzung des Förderbeirats
Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) hat anlässlich der Sitzung desFörderbeirats am 7. Dezember 2023 Daten zum ersten Förderaufruf auf der Grundlage dergeltenden Förderrichtlinie vorgelegt. Die bekannten Unsicherheiten im Hinblick auf dieAusgestaltung des Bundeshaushalts 2024 werden dazu führen, dass das BMDV in dennächsten Tagen den laufenden Förderaufruf für Beratungsleistungen vorläufig beendenwird. Auch Fast Lane Anträge, die unabhängig von einem Förderaufruf eingereicht werdenkönnen, werden zunächst nicht weiter beschieden werden können, weil diese Mittel dennoch nicht verabschiedeten Haushalt des Jahres 2024 belasten würden. Zur finanziellenAusstattung des Förderprogramms im Jahr 2024 konnte das BMDV angesichts der laufenden Haushaltsberatungen noch keine abschließende Aussage treffen.
Den thematischen Schwerpunkt der Sitzung bildete die Präsentation erster Daten zur Evaluation der Gigabitförderung. Insgesamt sind für 962 Projekte Bundesmittel in Höhe von6,8 Milliarden Euro beantragt worden. Angesichts des zur Verfügung stehenden Betragesan Bundesfördermitteln in Höhe von rund drei Milliarden Euro konnten davon nur 436 Projekte bewilligt werden. Dabei hat der Bund rund 500 Millionen Euro „nachgeschossen“, umseine Zusage einzuhalten, dass Projekte, durch die das jeweilige Landesbudget überschritten wird (sowie damit punktgleiche weitere Projekte) ebenfalls bewilligt werden.Diese Landesbudgets wurden in nahezu allen Bundesländern überschritten, besondersdeutlich in Baden-Württemberg (+500 Prozent) und Bayern (+240 Prozent). Lediglich inSchleswig-Holstein, im Saarland sowie in Sachsen-Anhalt wurde das Landesbudget nichtausgeschöpft. Aus den insoweit verbleibenden Geldern (375 Millionen Euro) konnten 49Projekte bewilligt werden.
Vierteljahresstatistik der Kommunalfinanzen 1. bis 3. Vierteljahr 2023
Das Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) hat die Tabelle mit den Ergebnissen dervierteljährlichen Kassenstatistik für Niedersachsen, drittes Quartal 2023, übersandt. Diebereinigten Einzahlungen (insgesamt) stiegen um 7,0 Prozent auf 23,9 Milliarden Euro.Die bereinigten Auszahlungen mit 11 Prozent auf 25,1 Milliarden Euro noch stärker. Im Ergebnis führt dies zu einem deutlich negativen Finanzierungssaldo von -1.210 MillionenEuro zum Stand 30. September 2023. Dieser ist über 900 Millionen Euro schlechter alszum vergleichbaren Vorjahreszeitpunkt. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stiegendeutlich um 13,9 Prozent (3,9 Milliarden Euro). Davon entfiel auf Baumaßnahmen ein Anstieg von 19,2 Prozent (2,2 Milliarden Euro). Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeitsanken hingegen um 3,6 Prozent auf 894,5 Millionen Euro.
Die Steuereinzahlungen stiegen in den ersten drei Quartalen um 7,7 Prozent. Die Hauptursache lag in einem massiven Anstieg der Gewerbesteuer (netto) mit +22,1 Prozent (alleinbei den kreisfreien Städten +42,5 Prozent). Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (- 4,6 Prozent) und an der Umsatzsteuer (-4,5 Prozent) war die Entwicklunghingegen gegenläufig. Die Grundsteuer entwickelte sich moderat positiv mit +1,8 Prozent.
Die Personalauszahlungen stiegen in den ersten drei Quartalen um 8,5 Prozent auf 5,45Milliarden Euro, die Sach- und Dienstleistungen um 12,2 Prozent auf 3,0 Milliarden Euround die Transferzahlungen um 12,3 Prozent auf 14,2 Milliarden Euro.
Die sich deutlich eintrübende kommunale Finanzlage lässt sich der Kassenstatistik erst mitzeitlicher Verzögerung entnehmen. Einerseits wird der insbesondere inflationsbedingtedeutliche Anstieg bei den Auszahlungen noch durch extreme Steigerungen bei der Gewerbesteuer überdeckt. Andererseits ist erkennbar, dass die Investitionen zunehmend nichtmehr aus eigener Liquidität finanziert werden können.
Energiewendebedingte Kosten des Netzausbaus
Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat Eckpunkte zur sachgerechten Verteilung der Mehrkosten aus der Integration von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien veröffentlicht und zur Konsultation gestellt. Ziel ist es, die energiewende-bedingtenKosten des Netzausbaus künftig gleichmäßiger auf alle Netznutzer zu verteilen. Der bisherige Regulierungsmechanismus führt dazu, dass die Höhe der Netzentgelte je nach Netzbetreiber und Region unterschiedlich ist.
Das beruht auf einer Reihe von Ursachen. Dazu gehört etwa die Auslastung der Netze.Ein weiterer Faktor ist die Besiedlungsdichte: In dünn besiedelten Gebieten werden dieNetzkosten auf weniger Netznutzer verteilt. Weitere Faktoren sind die Kosten des Engpassmanagements oder auch das Alter der Netze. Aktuell besonders bedeutsam ist allerdings, dass die Energiewende zu drastisch geänderten Anforderungen an die Netze führt.Auf Ebene der Übertragungsnetze spielt vor allem der – nicht zuletzt aufgrund der Abschaltung von Kernkraftwerken dringend erforderlich gewordene – Ausbau großer Stromtrassen eine Rolle. Auf Ebene der Verteilernetze besteht angesichts der zunehmend dezentralen Stromeinspeisung aus Windkraft- und Solaranlagen ein erheblicher Investitionsbedarf, der sich in steigenden Netzentgelten niederschlägt. Diese Entwicklungen habenzur Folge, dass die Netzentgelte insbesondere in den ländlichen Räumen – nur hier findetin größerem Umfang der Ausbau erneuerbarer Energien statt und besteht damit die Notwendigkeit, die Verteilernetze zu ertüchtigen – im Vergleich zu den Ballungsgebieten deutlich höher sind. Auch auf der Ebene der Bundesländer bestehen erhebliche Unterschiede.Derzeit sind die Belastung derzeit vor allem in den Ländern Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern überproportional hoch.
Vor diesem Hintergrund schlägt die BNetzA einen neuen Regulierungsrahmen vor. Diesersieht als ersten Schritt vor, zu ermitteln, ob ein Netzbetreiber von einer besonderen Kostenbelastung aus dem Ausbau der Erneuerbaren Energien betroffen ist. Wenn das der Fallist, kann die in einem zweiten Schritt ermittelte Mehrbelastung über einen netzbetreiberindividuellen Wälzungsbetrag bundesweit verteilt werden. Entlastet werden auf diese Weise vor allem Netzbetreiber in Brandenburg (217 Millionen Euro), Schleswig-Holstein (184 Millionen Euro), Sachsen-Anhalt (88 Millionen Euro), Mecklenburg-Vorpommern (44 MillionenEuro), Bayern (40 Millionen Euro) und Niedersachsen (26 Millionen Euro).
Sachstand zum Gesetzentwurf für eine kommunale Wärmeplanung
Der Deutsche Bundestag hat am 17. November 2023 das Gesetz für die Wärmeplanungund zur Dekarbonisierung der Wärmenetze verabschiedet. Der Bundesrat hat dem Gesetzam 15. Dezember 2023 zugestimmt. Ein Inkrafttreten ist weiterhin zum 1. Januar 2024 geplant. Das Gesetz sieht eine Verpflichtung der Länder vor, Wärmeplanungen durchzuführen. Die Länder können diese Aufgabe auf die Kommunen übertragen.
Kernstück der Wärmeplanung ist die Ausweisung von Wärmeversorgungsgebieten. Dabeiwird dargestellt, welche Wärmeversorgungsart für ein Gemeindegebiet besonders geeignet ist. Die Ausweisung erfolgt auf Basis einer Bestandsanalyse, mit der die bestehendeWärmeversorgung ermittelt wird, sowie einer Potenzialanalyse. Bis zum Jahr 2030 müssen Wärmenetze zu einem Anteil von 30 Prozent und bis 2040 zu einem Anteil von80 Prozent aus Erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme gespeist werden.Neue Wärmenetze müssen bereits ab dem 1. März 2025 einen Anteil von 65 Prozent aufweisen.
Entsprechend der Forderungen der kommunalen Spitzenverbände wurde u.a. die Beschränkung der Abfälle, die Quelle unvermeidbarer Abwärme sein können, auf überlassungspflichtige Abfälle zurückgenommen. Auch wurden die Beschränkungen für den Einsatz von Biomasse in mittelgroßen Netzen gelockert und die Errichtung sowie der Betriebvon Anlagen zur Erzeugung von Wärme aus erneuerbaren Energien liegen im überragenden öffentlichen Interesse. Ergänzend zum Wärmeplanungsgesetz erfolgen Änderungendes Baugesetzbuchs, die die bauplanungsrechtliche Umsetzung der Wärmeplanung unterstützen, sowie eine Anpassung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung.
Ein großer Kritikpunkt im Prozess zum Aufbau einer bundesweit verbindlichen Wärmeplanung bleibt weiterhin die nicht geklärte Finanzierung. Der Deutsche Landkreistag (DLT)hat deshalb bereits mehrfach verdeutlicht, dass die Übertragung der Wärmeplanung aufdie kommunale Ebene eine neue Aufgabe für die Kommunen darstellt und die Kosten vonden Ländern vorbehaltslos finanziell ausgeglichen werden müssen.
Bericht zum Ausbaustand der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder
Die Bundesregierung hat den Ersten Bericht über den Ausbaustand der ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulkinder (GaFöG) beschlossen. Der Berichtstellt den aktuellen Ausbaustand ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter dar und berechnet aufbauend auf prognostizierten Elternbedarfendie Spannbreite der zukünftig benötigten Ganztagsplätze. Dabei wurde die länder- und regionalspezifische Heterogenität der Ausgestaltung der Ganztagsangebote berücksichtigt.
Der GaFöG-Bericht fußt auf bestehenden Statistiken aus den Bereichen Schule und Kindertagesbetreuung. Gleichzeitig weist der Bericht auch auf bestehende Datenlücken hin.Der Bericht geht davon aus, dass bis zum Inkrafttreten des Gesetzes im Jahr 2026 rund470.000 Ganztagsplätze zusätzlich benötigt werden. Zudem nutzen die Länder die Finanzhilfen des Bundes bislang vorwiegend für den qualitativen Ausbau. Im Schuljahr2021/2022 nutzte bereits jedes zweite Kind im Grundschulalter ein Ganztagsangebot.
Verordnungsvorschlag der EU-Kommission zu Tiertransporten
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat dem Deutschen Landkreistag (DLT) einen Verordnungsvorschlag der EU-Kommission zu Tiertransporten übermittelt.Vorgesehen sind u. a. folgende Änderungen:
– Die Transportzeiten werden verkürzt und bei langen Transporten müssen die Tierezum Ruhen, Füttern und Tränken abgeladen werden. Für Schlachttiere und gefährdeteTiere gelten besondere Vorschriften.
– Das Platzangebot für die verschiedenen Tiere wird erhöht und an die jeweilige Tierartangepasst.
– Für den Transport bei extremen Temperaturen gelten strenge Bedingungen, darunterdie Beschränkung des Transports auf die Nacht, wenn die Temperaturen 30°C übersteigen. Außerdem müssen bei Temperaturen unter 0°C die Fahrzeuge abgedeckt unddie Luftzirkulation im Tierraum kontrolliert werden.
– Die Vorschriften für die Ausfuhr von lebenden Tieren aus der Union werden verschärft,einschließlich besserer Kontrollen in Drittländern, damit sie den in der EU geltendenStandards entsprechen.
– Digitale Instrumente sollen die Durchsetzung der Transportvorschriften erleichtern (z.B.Echtzeit-Ortung von Fahrzeugen, zentrale Datenbank).
Gerichte heben Untersagung eines Tiertransports nach Marokko auf
Durch einen Erlass „Lange Beförderungen von Rindern in bestimmte Drittstaaten“ wurdeden kommunalen Veterinärbehörden am 22. November 2023 durch das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML) die Abfertigung von Tiertransportenin bestimmte Drittländer untersagt. Unter Bezugnahme auf diesen Erlass sowie eine konkrete Weisung des ML hat ein Landkreis mit Verfügung vom 29. November 2023 denTransport von tragenden Zuchtrindern am 18. und 19. Dezember 2023 nach Marokko austierschutzrechtlichen Gründen untersagt und die sofortige Vollziehung angeordnet. Mit Beschluss vom 8. Dezember 2023 hat das Verwaltungsgericht Osnabrück dem Eilantrag eines Rindertransportunternehmens stattgegeben, der sich gegen die verfügte Untersagungdes Rindertransports richtete.
Das Gericht hat den Landkreis dazu verpflichtet, die vom Transportunternehmer vorgelegten Fahrtenbücher abzustempeln und den Transport abzufertigen. Der Beschluss ist dahingehend begründet, dass die vom Landkreis auf Weisung des ML herangezogeneRechtsgrundlage des § 16 a Abs. 1 Satz 1 TierSchG eine konkrete Gefahr eines tierschutzrechtlichen Verstoßes erfordere. Der – vom Landkreis mit dem ML abgestimmte –angefochtene Bescheid enthalte jedoch keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass einetierschutzwidrige Behandlung hinreichend wahrscheinlich sei.
Die gegen die erstinstanzliche Entscheidung vom Landkreis auf Weisung des ML eingelegte Beschwerde hat der 11. Senat des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts am15. Dezember 2023 zurückgewiesen. Zur Begründung hat er ausgeführt, die für die Verbotsverfügung erforderliche konkrete Gefahr habe der diesbezüglich darlegungs- und beweispflichtige Landkreis nicht dargelegt. Die Annahme einer konkreten Gefahr erfordere,dass im konkreten Einzelfall in absehbarer Zeit mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eintierschutzwidriger Vorgang zu erwarten sei. In dem angefochtenen Bescheid werde lediglich darauf abgestellt, dass in Marokko betäubungslos geschlachtet werde. Nur das ergebesich auch aus dem von dem Antragsgegner dem Bescheid beigefügten Nachweisen undQuellenangaben. Damit werde indes keine zeitlich und örtlich eingrenzbare Situation beschrieben, die die Annahme einer konkreten Gefahr rechtfertigen würde. Konkrete Umstände, die darauf hindeuteten, dass auch die von der Antragstellerin auszuführenden Rinder in einer im vorbezeichneten Sinne zu verstehenden absehbaren Zeit betäubungslosgeschlachtet werden sollten, fehlten. Vielmehr sei davon auszugehen, dass die Tiere nichtzum Zwecke der Schlachtung, sondern zu Zwecken der Milchgewinnung exportiert würden.
Anpassung des nationalen an das EU-Tiergesundheitsrecht
Die EU-Kommission arbeitete von 2013 bis 2021 an einer umfassenden Neuordnung desEU-Tiergesundheitsrechts mit dem Ziel, das zergliederte gemeinschaftliche Tierseuchenrecht mit seinen zahlreichen Richtlinien, Beschlüssen und Verordnungen in einem transparenten Rechtsrahmen zu vereinheitlichen und zu vereinfachen. Am 21. April 2021 ist dasneue Tiergesundheitsrecht mit der Verordnung (EU) 2016/429 („Animal Health Law“, AHL)und weiteren ergänzenden Delegierten Verordnungen und Durchführungsverordnungenschließlich in Kraft getreten. Die neuen Regelungen überlagern zu großen Teilen das nationale Tiergesundheitsrecht.
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat ein Eckpunktepapier vorgelegt, das einen Überblick über einen ersten Teil der Anpassung des nationalenTiergesundheitsrechts gibt. Als mögliche Elemente für einen ersten Schritt der Überarbeitung nennt das BMEL:
– neue Regelungen bzgl. der Meldung von Tierseuchen;
– Übernahme der Begriffsbestimmungen, die im direkt geltenden EU-Recht festgelegtsind, sowie entsprechende Folgeänderungen im Tiergesundheitsgesetz (TierGesG);
– Anpassung bestehender bzw. Schaffung neuer Ermächtigungsgrundlagen für Regelungen zur Meldung von Seuchen;
– Anhebung des Höchstsatzes der Entschädigung für den Verlust von Geflügel;
– Anpassung weiterer Regelungen im TierGesG zu Diagnoseverfahren, zur Aufgabenübertragung an das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit sowie zu Meldepflichten des Tierhalters;
– Aufhebung der Rinder-Salmonellose-Verordnung;
– Anpassung einzelner Regelungen des TierGesG aus Gründen der Rechtsklarheit andie Vorschriften der Verordnung (EU) 2019/6 im Hinblick auf Regelungen zu immunologischen Tierarzneimitteln.
EU-Kommission zum Tierschutz bei Hunden und Katzen
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat dem Deutschen Landkreistag (DLT) einen Verordnungsvorschlag der EU-Kommission zum Tierschutz bei Hundenund Katzen übermittelt. Dieser zielt darauf ab, EU-weit Mindeststandards für die Zucht,Unterbringung, Pflege und Behandlung dieser Tiere einzuführen. Der Vorschlag enthältkeine neuen Vorschriften für Bürger und Tierhalter. Er legt einheitliche EU-Vorschriften fürdas Wohlergehen von Hunden und Katzen fest, die in Zuchteinrichtungen, Zoohandlungenund Tierheimen gezüchtet oder gehalten werden.
Überarbeitete allgemeine De-minimis-Verordnung sowie De-minimis-DAWI
Die EU-Kommission hat am 13. Dezember 2023 die überarbeitete allgemeine De-minimisVerordnung sowie die De-minimis-Verordnung für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) angenommen. Die neuen Vorschriften sehen insbesonderedie inflationsbedingte Erhöhung der De-Minimis-Schwellenwerte sowie die verpflichtendeEinrichtung eines nationalen Registers für De-Minimis-Beihilfen vor. Die Verordnungen treten am 1. Januar 2024 in Kraft.
Die allgemeine De-minimis-Verordnung gilt für alle Dienstleistungen, die nicht DAWI sind.
Die neue Verordnung umfasst u.a. die folgenden wesentlichen Änderungen:
– Die Anhebung des Höchstbetrags pro Unternehmen von 200.000 Euro (seit 2008) auf300.000 Euro über drei Jahre, um der Inflation Rechnung zu tragen (Art. 3 VO).
– Die Einführung einer Verpflichtung für die Mitgliedstaaten, De-minimis-Beihilfen ab dem1. Januar 2026 in einem auf nationaler oder EU-Ebene eingerichteten Zentralregisterzu registrieren (Art. 6 VO).
Folgende wesentliche Änderungen werden für Beihilfen zur Erbringung von DAWI festgelegt.
– Die Anhebung des Höchstbetrags pro Unternehmen von 500.000 Euro auf 750.000Euro über einen Zeitraum von drei Jahren, um der Inflation Rechnung zu tragen.
– Die Einführung einer Verpflichtung für die Mitgliedstaaten, De-minimis-Beihilfen ab dem1. Januar 2026 in einem auf nationaler oder EU-Ebene eingerichteten Zentralregisterzu registrieren.
– Aufnahme des Begriffs „ein einziges Unternehmen“ („Konzernbetrachtung“) mit besonderen Regelungen für „Öffentliche Einrichtungen“ und Einrichtungen ohne Erwerbszweck.
Der Deutsche Landkreistag (DLT) hatte sich im Vorfeld der Überarbeitungen gemeinsammit den beiden kommunalen Schwesterverbänden mehrfach und nachdrücklich für eineVerdreifachung der Schwellenwerte auf 600.000 Euro für allgemeinen Beihilfen und 1,5Millionen Euro für DAWI-Beihilfen ausgesprochen. Ferner hatten die Verbände (so auchdie Bundesregierung) das verpflichtende Register abgelehnt und für eine Fortgeltung desbisherigen Systems der Eigenerklärungen der Unternehmen plädiert.
RKI-Empfehlungen zum Umgang mit Corona in der Pflege
Das Robert Koch-Institut (RKI) hat seine „Empfehlungen zum Umgang mit SARS-CoV-2 inder Pflege/Betreuung (außerhalb des Krankenhauses)“ aktualisiert. Der Leitfaden richtetsich an stationäre und teilstationäre Pflegeeinrichtungen, ambulante Pflegeeinrichtungen(Einrichtungen der häuslichen Pflege/Pflegedienste) und Einrichtungen für betreutes Wohnen und Wohnassistenz. Die Empfehlungen sind unter folgendem Link zu finden:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Pflege/Dokumente.html
Studienberichte zu Lehren aus der Pandemie
Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hatte systematische Auswertungen zu„Lehren aus der Corona-Pandemie und zukünftige Krisenresilienz in der Langzeitpflege“ inAuftrag gegeben. Hierzu liegen folgende Studienberichte vor:
– Teil 1: Ergebnisbericht „Analyse der Auswirkungen der Corona-Pandemie in der Pflege 2020–2022“ (pflegenetzwerk-deutschland.de)
– Teil 2: Ergebnisbericht „Qualitative Befragung von Leitungspersonen stationärer Pflegeeinrichtungen sowie weiterer Expertinnen und Experten aus der Pflege zu ihren Erfahrungen aus der Corona-Pandemie“ (pflegenetzwerk-deutschland.de)
Trinkwassereinzugsgebieteverordnung im Bundesgesetzblatt verkündet
Die Verordnung über Einzugsgebiete von Entnahmestellen für die Trinkwassergewinnungist im Bundesgesetzblatt verkündet worden. Sie dient der Umsetzung der Vorgaben derEU-Trinkwasserrichtlinie in Bezug auf den Schutz des Wassers in den Einzugsgebietenvon Entnahmestellen für die Trinkwassergewinnung. Die Forderungen der kommunalenSpitzenverbände sind nach Angaben des Deutschen Landkreistages (DLT) zumindest inTeilen aufgegriffen worden.
So wurde in § 3 Abs. 2 TrinkwEGV die Frist zur Bewertung von Einzugsgebieten bis 2026herausgenommen und die Pflicht zur Überprüfung des Untersuchungsprogrammes beginnt statt im Januar 2027 nun im Mai 2027. Außerdem wurden u.a. die Regelungen zurBestimmung und Beschreibung des Einzugsgebietes und zur Unterrichtungspflicht des Betreibers überarbeitet. Dennoch wird sich weiterhin ein Mehraufwand für die unteren Wasserbehörden, Gesundheitsbehörden und die Wasserversorger ergeben.
Entwurf eines Berufsbildungsvalidierungs- und -digitalisierungsgesetzes
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat dem Deutschen Landkreistag (DLT) den Entwurf eines Berufsbildungsvalidierungs- und -digitalisierungsgesetzes (BVaDiG) übersandt. Schwerpunkte des Gesetzentwurfs, in dem Änderungen im Berufsbildungsgesetz vorgesehen sind, liegen in den Bereichen:
– Feststellungen und Bescheinigungen individueller beruflicher Handlungsfähigkeit, dieunabhängig von einem formalen Berufsbildungsabschluss erworben wurde (Validierung);
– Digitalisierung von Dokumenten und Verfahren nach dem Berufsbildungsgesetz.
Hierdurch soll aus Sicht des BMBF zum einen ein attraktives und anschlussfähiges Angebot für die Zielgruppe der Menschen ohne Berufsabschluss in der beruflichen Bildung geschaffen werden, um Fachkräftepotenziale bestmöglich auszuschöpfen. Zum anderen sollen durch die größtmögliche Digitalisierung im Berufsbildungsgesetz Bürokratie abgebautund der Digitalisierung im Bereich der Berufsbildung Schub verliehen werden.
Wettbewerbsaufruf „Der Deutsche Fahrradpreis 2024“
„Der Deutsche Fahrradpreis“ wird auch im Jahr 2024 wieder vom Bundesministerium fürDigitales und Verkehr (BMDV) gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- undfahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. (AGFS), dem Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) und dem Verbund Service und Fahrrad e.V. (VSF) vergeben. DerWettbewerb will durch Prämierung und Vorstellung von innovativen Best-Practice-Beispielen das Fachpublikum und die Entscheidungsträger dafür gewinnen, den Radverkehr(noch mehr) zu fördern.
Der Wettbewerb soll durch die begleitende Öffentlichkeitsarbeit die Popularität des Radfahrens noch weiter steigern. Der Preis wird in den drei Kategorien „Infrastruktur“, „Serviceund Kommunikation“ sowie neu in der Kategorie „Ehrenamt“ vergeben. Er ist in diesemJahr mit insgesamt 15.000 Euro dotiert. Die Bewerbungsphase hat am 1. Dezember 2023begonnen. Einsendeschluss ist der 10. Januar 2024. Bewerbungen können online eingereicht werden unter: https://www.der-deutsche-fahrradpreis.de/wettbewerb/
Flutung der Havelpolder und Einrichtung einer gemeinsamen Schiedsstelle
Der Ausschuss für Umwelt, Energie und Klimaschutz des Niedersächsischen Landtageshat den Entwurf eines Gesetzes zu dem Staatsvertrag über die Flutung der Havelpolderund die Einrichtung einer gemeinsamen Schiedsstelle zur Abgabe einer Stellungnahme imschriftlichen Verfahren übersandt. Der Staatsvertrag soll die Flutung der in den LändernBrandenburg und Sachsen-Anhalt gelegenen Havelpolder im Falle eines gefahrbringenden Hochwassers regeln. Das Gebiet des Landes Niedersachsen ist als Unterlieger vonden Maßnahmen betroffen. Der bisherige Staatsvertrag vom 6. März 2008 soll gleichzeitigaußer Kraft treten.
Rohentwurf für eine Bundes-Klimaanpassungsstrategie
Im Entwurf des Bundes für ein Klimaanpassungsgesetz ist aktuell vorgesehen, dass dieBundesregierung bis spätestens September 2025 eine vorsorgende Klimaanpassungsstrategie mit messbaren Zielen entwickelt, nachfolgend umsetzt und unter Berücksichtigungaktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse alle vier Jahre fortschreibt. Ungeklärt bleibt weiterhin die Finanzierung der Klimaanpassungsmaßnahmen, worauf der Deutsche Landkreistag bereits mehrfach gedrängt hat. Sowohl der Bundestag als auch der Bundesrat haben dies aufgegriffen und fordern die Bundesregierung auf, eine Finanzierung sicherzustellen.
Vor diesem Hintergrund hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) den ersten Entwurf für eine Klimaanpassungsstrategie vorgelegt. Darin werden messbare Ziele in den Themenbereichen Gesundheit,Infrastruktur, Land und Landnutzung, Stadtentwicklung, Raumplanung und Bevölkerungsschutz, Wasser, Wirtschaft und Übergreifendes dargestellt.
Bockhop zum neuen Präsidenten der niedersächsischen Sparkassen gewählt
Die Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes Niedersachsen (SVN) hat am15. Dezember 2023 einstimmig ihren Vorsitzenden Cord Bockhop, Landrat des Landkreises Diepholz, als Präsident des SVN gewählt. Der 56-jährige Diepholzer wird das Amt alsoberster Repräsentant der niedersächsischen Sparkassen und ihrer kommunalen Trägerzum 1. Juli 2024 übernehmen. Er tritt damit die Nachfolge von Thomas Mang an, der dasAmt seit Februar 2003 innehat und Ende Juni des kommenden Jahres in den Ruhestandgeht.
Der SVN ist einer von zwölf regionalen Sparkassen- und Giroverbänden in Deutschland.Er setzt sich zusammen aus den 39 kommunalen Sparkassen, deren kommunalen Trägern sowie der Braunschweigischen Landessparkasse.
Der SVN ist eine Körperschaft desöffentlichen Rechts. Seine Aufgabe ist es, die Sparkassen in Niedersachsen zu fördern.Die Landkreisversammlung des Niedersächsischen Landkreistages (NLT) wird am 7. März2024 über die Nachfolge von Landrat Bockhop als Vizepräsident des NLT ab 1. Juli 2024und ab 1. September 2024 als Präsident des NLT zu entscheiden haben.